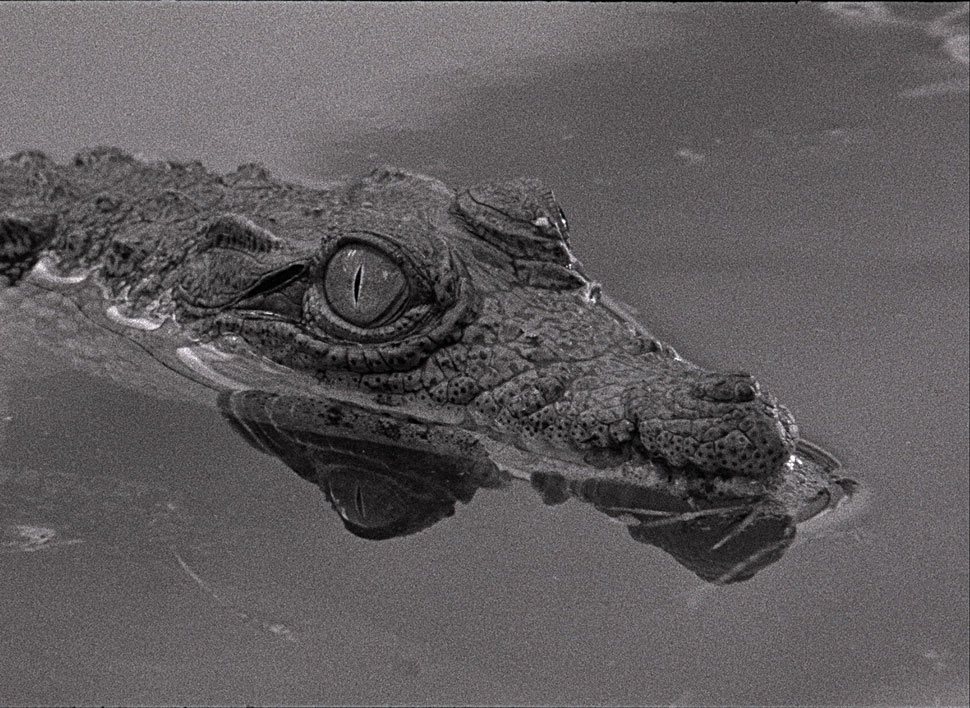62. Berlinale: Preisträger, Eindrücke, Erkenntnisse
Zum 62. Mal fanden in diesem Jahr die Internationalen Filmfestspiele in Berlin statt. Wie üblich, bot auch der 2012er-Jahrgang ein bunt gemischtes Bild, das von großer Filmkunst bis in unsägliche Abgründe des Filmschaffens reichte: Ganz so wie es sein muss.
Allgemein wird das Niveau der diesjährigen Berlinale in der Branche und in der Presse gelobt, auch wenn es natürlich andere Stimmen gibt. Manche, die das größte deutsche Filmfestival im Vorjahr an einem Tiefpunkt sahen, konstatieren nun, dass die Wende gelungen und wieder ein recht hohes Niveau erreicht sei.
Ein solches negatives oder positives Gesamturteil abzugeben, das erfordert entweder viel Chuzpe und Selbstüberschätzung oder — wenn es mehr als nur ein Bauchgefühl sein soll — einen großen redaktionellen Stab vor Ort: Schließlich laufen während der Berlinale an 22 Spielorten, viele davon mit mehreren Kinosälen ausgestattet, innerhalb von elf Festivaltagen insgesamt rund 650 digitale und analoge Filme sowie zusätzlich noch Videos, wenn man alle Sektionen des Festivals und die Vorführungen des parallel stattfindenden Händlermarkts EFM zusammenfasst. In Wahrheit kann also praktisch jede Berlinale-Berichterstattung nur einen Ausschnitt der Veranstaltung darstellen.
Letztlich bleibt die Bewertung von Filmen aber ohnehin eine individuelle Geschmacks- und Meinungsfrage, die Modetrends unterliegt und im jeweiligen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Kontext gesehen werden muss: Wer kennt nicht die Enttäuschung, die eintreten kann, wenn man nach vielen Jahren einen Film wieder sieht, den man früher liebte und für große Kunst hielt, der einem aber bei neuerlicher Betrachtung abgeschmackt, altmodisch und aus der Zeit gefallen vorkommt. Oder andererseits auch die Freude darüber, beim Betrachten eines alten Films neue Aspekte von dessen zeitloser Qualität und dessen visionärer Kraft zu entdecken.
Diesen »Test of Time« haben die Berlinale-Filme noch vor sich, von denen in diesem Jahr erfreulich viele in Berlin Europa- oder Weltpremiere feierten.
Die Gewinner des Hauptpreises der Berlinale 2012 haben ihren persönlichen »Test of Time« dagegen schon hinter sich und haben ihn erfolgreich bestanden: Mit dem Goldenen Bären wurden die beiden italienischen Regielegenden Paolo und Vittorio Taviani ausgezeichnet — Paolo ist 80 und sein älterer Bruder Vittorio 82 Jahre alt.
Die Tavianis begleiteten für ihren Film »Cesare deve morire« (auf deutsch: »Cäsar muss sterben«) sechs Monate lang Häftlinge in einem Hochsicherheitstrakt des römischen Gefängnisses Rebibbia und filmten halbdokumentarisch, was die Proben und die Aufführung bei den Insassen bewirken.
Manchen geht diese Verbeugung der Berlinale-Jury unter Vorsitz des britischen Regisseurs Mike Leigh vor den Tavianis zu weit, sie hätten lieber einen der anderen, im Vorfeld als Favoriten gehandelten Filme mit dem Goldenen Bären belohnt gesehen — die meisten davon wurden aber wenigstens mit anderen Preisen bedacht.
Weitere Preise
Wettbewerbsfilme, Preise der internationalen Jury
- Großer Preis der Jury – Silberner Bär: »Csak a szél« (internationaler Titel: »Just The Wind«) von Bence Fliegauf.
- Silberner Bär für die beste Regie: Christian Petzold für »Barbara«.
- Silberner Bär für die beste Darstellerin: Rachel Mwanza in »Rebelle« (internationaler Titel: »War Witch«) von Kim Nguyen.
- Silberner Bär für den besten Darsteller: Mikkel Boe Følsgaard in »En Kongelig Affære« (internationaler Titel: »A Royal Affair«) von Nikolaj Arcel.
- Silberner Bär für eine herausragende künstlerische Leistung: Lutz Reitemeier für die Kamera in »Bai lu yuan« ((internationaler Titel: »White Deer Plain«) von Wang Quan’an.
- Silberner Bär für das beste Drehbuch: Nikolaj Arcel, Rasmus Heisterberg für »En Kongelig Affære« (internationaler Titel: »A Royal Affair«) von Nikolaj Arcel.
- Sonderpreis – Silberner Bär: »L’enfant d’en haut« (internationaler Titel: »Sister«} von Ursula Meier.
- Alfred-Bauer-Preis, in Erinnerung an den Gründer des Festivals, für einen Spielfilm, der neue
Perspektiven der Filmkunst eröffnet: »Tabu« von Miguel Gomes.
Jury für den besten Erstlingsfilm
- Bester Erstlingsfilm, dotiert mit 50.000 Euro, gestiftet von der GWFF: »Kauwboy« von Boudewijn Koole. Dieser Film lief bei der Berlinale in der Kategorie Generation Kplus.
- Lobende Erwähnung: »Tepenin Ardı« (internationaler Titel: »Beyond the Hill«) von Emin Alper. Dieser Film lief bei der Berlinale in der Kategorie Forum.
Preise der Internationalen Kurzfilmjury
- Goldener Bär: »Rafa« von João Salaviza
- Preis der Jury – Silberner Bär: »Gurehto Rabitto« (internationaler Titel: »The Great Rabbit«) von Atsushi Wada.
- Lobende Erwähnung: »Licuri Surf« von Guile Martins.
- EFA Short Film Nominee Berlin: »Vilaine Fille Mauvais Garçon« (internationaler Titel: »Two Ships«) von Justine Triet.
- DAAD Kurzfilmpreis: »The Man that Got Away« von Trevor Anderson.
Außerdem wurden noch zahlreiche weitere Preise für Kinder- und Jugendfilme verliehen, sowie Preise unabhängiger Jurys, von Verbänden, Zeitungslesern und dem Publikum. (PDF-Download der kompletten Liste mit allen insgesamt 62 Filmpreisen am Textende.) Zudem verlieh die Berlinale auch einen Ehrenbären an die Schauspielerin Meryl Streep und jeweils eine Berlinale-Kamera an den Regisseur Haro Senft und den Erfinder Ray Dolby.
Festivalbericht, Eindrücke, ausgewählte Filme
Die Berlinale ist das größte Filmfestival in Deutschland, sie hat unter den Filmfestivals mindestens europaweite und in einigen Aspekten sicher auch weltweite Bedeutung — und sie kann mit ihrer diesjährigen 62. Ausgabe auch auf eine stattliche Tradition zurückblicken. Seit ihrer Gründung als Medienwerkzeug des kalten Krieges hat sie sich immer wieder neu erfunden und weiterentwickelt. Auch wenn die ganz wilden Jahre längst vorbei und die damals jungen Protestler — in Ehren ergraut oder ihres Haupthaars verlustig gegangen — nun selbst ihr einstiges Aufbegehren in milderem Alterslicht sehen: Eine alte Tante ist die Berlinale glücklicherweise nicht geworden. Selbst wenn man unbestreitbar hier und da mittlerweile eine gewisse Bräsigkeit entdecken kann, ist die Berlinale auch stets ein Schaufenster der aktuellen Filmkultur geblieben und ein Ausguck in andere Bereiche der Kultur weltweit.
»Ang Babae sa Septic Tank«
Wie schön, dass es in diesem Jahr mehrere Filme gab, die auch genau mit diesem Schaufenstereffekt spielen. Allen voran — und unter diesem Aspekt ein wirklich herausragender Film — »Ang Babae sa Septic Tank«. Produzent und Regisseur dieses Films gehören als Werbefilmer zur Oberschicht der Philippinen. Ihr Film setzt sich in Form und Inhalt damit auseinander, was die westlichen Festivalveranstalter und -besucher offenbar von einem Film aus einem Land erwarten, in dem 80 % der Bevölkerung von weniger als einem US-Dollar pro Tag leben müssen: die filmische Darreichung von Armut, Elend und Gewalt im klassischen Betroffenheits-Ghetto-Film.
In diesem Film aber spielt ein junges Team aus Regisseur und Produzent, begleitet von einer Produktionsassistentin, unterwegs zwischen Networking, einem Treffen mit der Wunschhauptdarstellerin und der Location-Suche, die verschiedenen Möglichkeiten durch, wie man einen sicheren Festival-Hit von den Philippinen inszeniert. Armut, Elend, Hunger, Kinderhandel, Pädophilie, in einer rührseligen Geschichte aufbereitet, mal als Dokudrama, mal als Musical-Film verpackt — das alles und mehr wird virtuos und mit viel Humor durchdekliniert — ohne dass die feine Linie zum »Eure Armut kotzt mich an«-Minengebiet übertreten würde. Der Film — auf den Philippinen übrigens ein Blockbuster, der es dort mit »Captain America« und »Harry Potter« aufnehmen konnte — hält der westlichen Kinowelt und besonders auch den hiesigen Festivalverantwortlichen auf höchst unterhaltsame Weise den Spiegel vor.
Das Festival als Festival
Damit ist auch das Thema der hohen Spezialisierung in der Filmproduktion angesprochen: Es gibt eben heute nicht nur den optimal auf eine kaufkräftige Zielgruppe optimierten, exakt für die jeweilige kommerziell Nische produzierten, auf eine ganz bestimmte Marktlücke abgestimmten, unterhaltenden Kinofilm, der rein marktorientiert, ausschließlich aus wirtschaftlichem Interesse produziert wird, sondern auch den genauso zielgenau konzipierten Festivalfilm.
Bei einem Festival wie der Berlinale spielt das nicht beruflich anwesende Publikum — auch wenn das manchmal anders dargestellt wird — nur eine kleine Nebenrolle. Es geht im wesentlichen darum, eine Jury zu überzeugen und möglichst noch einen großen Teil der Kritikerkaste. Die Macher wollen sich exponieren, ins Gespräch bringen, zukünftige Jobs akquirieren, Geldquellen finden. Das Festival und der Festivalfilm sind somit ein System in sich, das am besten läuft, wenn es autonom und autark operieren kann, wenn es nicht von außen gestört wird, wenn die Realität der Kinowirtschaft außen vor bleibt, wenn Filmschaffende, Presse, Verbände, Stiftungen, Förder- und Fernsehanstalten im wesentlichen unter sich bleiben können. Wird etwa ein Film während des Festivals zum Publikumshit, dann sorgt das — sarkastisch zusammengefasst — nur für logistische Probleme.
Mit der Realität hat ein Filmfestival also so gut wie nichts zu tun — aber das ist ja beim Film sozusagen systemimmanent: Je größer das Budget, um so weiter kann man sich von der heutigen Realität entfernen, vom Kostümfilm bis zur Zukunftsvision oder in gänzlich erfunden Welten. Da ist es fast schon logisch, dass sich ein Filmfestival — sozusagen als Abstraktion der Abstraktion — auf allen Ebenen immer weiter von der Realität emanzipiert.
Ein weiteres Indiz dafür kann man leicht bei den Veranstaltungen, Partys und Empfängen finden, von denen man früher gesagt hätte, dass sie am Rande des Festivals stattfinden, die aber mittlerweile für zahlreiche Besucher zum Zentrum der Berlinale mutiert sind. Dort kann man viele Menschen treffen, die in der Formulierung zwar bedauernd, aber im Kern durchaus stolz verkünden, dass sie »leider, leider« während des ganzen Festivals noch gar keinen Film gesehen haben, weil sie ja ständig so wahnsinnig wichtige Gespräche führen, Treffen organisieren und Termine wahrnehmen müssen — obwohl sie in Wahrheit nicht das geringste mit den offiziellen Festivalabläufen zu tun haben.
Das Festival als Medien- und Marketingereignis
Roter Teppich, Limousinen-Service, Fotografen, die auf Aluleitern stehend versuchen, schreiend die Aufmerksamkeit der Promis und einen Blick in ihre Richtung zu erheischen. Journalisten, die in der Pressekonferenz nach dem Film nur Fragen zum Privatleben der Schauspieler stellen, ohne jeden Bezug zum Film. Das ist die Realität der Berlinale — und praktisch aller anderen A-Festivals.
Dennoch wird in der Boulevardpresse in jedem Jahr beklagt, es seien zu wenig internationale Stars bei der Berlinale anwesend.
Nur Romantiker glauben noch, auf diesem Jahrmarkt der Eitelkeiten seien die Filme die Stars. Dem ZDF als einem der drei Hauptsponsoren nimmt man ein grundsätzliches Interesse an den Filmen ja gerade noch ab. Bei BMW und L’Oreal wird das schon etwas abstrakter.
Aber wahrscheinlich geht es tatsächlich nicht mehr anders: Man braucht den ganzen Ballyhoo, um das Geld zusammen zu bekommen, von dem dann ein Teil genutzt wird, um Filme zeigen zu können.
Einige ausgewählte Filme
Ach ja, die Filme: Jetzt wären sie in diesem Bericht auch fast untergegangen. Der Autor dieses Artikels hat während der Berlinale 23 Filme gesehen, etwa die Hälfte davon waren Kurzfilme mit einer Länge zwischen 3 und 43 Minuten. Bei der folgenden Auswahl von neun Filmen war der Kinobesuch aus ganz persönlicher Sicht keine Zeitverschwendung (anklicken des Titels führt jeweils zu umfangreichen Infos zum einzelnen Film auf der Berlinale-Website, solange diese dort noch freigeschaltet sind):
- Langfilme: »Barbara« (Silberner Bär), »Captive«, »Jin ling Shi San Chai«, »Shadow Dancer«, »Tabu« (Alfred-Bauer-Preis), »Ang Babae sa Septic Tank«, »Diaz — Don’t Clean Up This Blood«,
- Kurzfilme: »The End«, »Ein Mädchen namens Yssabeau«
Inhaltsleere, Langeweile, Apathie
Es wäre ziemlich dumm und arrogant, Filmen die Daseinsberechtigung abzusprechen, die einem nicht gefallen haben, oder die man nicht verstanden hat. Dennoch muss auch harte Kritik erlaubt sein: Was in diesem Berlinale-Jahr an Kurzfilmen aufgeboten wurde, das war zum weitaus größten Teil unterirdisch, was die handwerkliche Qualität angeht — und nur um die soll es hier gehen. Dass man mit alten Erzählmustern und Arbeitsweisen brechen kann und mitunter muss, um wirklich Neues zu gestalten: Geschenkt. Wenn aber endlos wackelnde, herumeiernde, entsättigte, fehlbelichtete Bilder nur noch Selbstzweck sind, wenn sie das wenige, das inhaltlich vielleicht noch da wäre zerstören, dann ist man endgültig in der Grauzone zwischen Beliebigkeit, Unfähigkeit und L’art pour l’art angekommen. Platt gesagt: Film ist Kommunikation. Wer durch sein Werk nicht kommunizieren will, der soll keinen Film machen. Und wer als Filmemacher glaubt, man müsse einfach nur ganz ohne zusätzliches Licht drehen und einen entsättigten, flauen, kontrastarmen Look produzieren, dann entstehe automatisch Kunst, der täuscht sich eben.
Beim Blick in die oft ratlosen Gesichter der Kinobesucher, konnte man in diesem Jahr oft die Frage lesen: Wer sucht diesen Schrott bloß aus? Wenn selbst das meistens recht belastbare und offene Festivalpublikum schon stöhnt und ächzt, sich nicht mal mehr zu Buhrufen aufraffen kann und keine einzige Frage an die anwesenden Filmemacher stellt, dann sollte die jeweilige Auswahlkomission vielleicht doch mal in sich gehen. Wer langweiligen, verquasten Schrott handwerklich schlecht produziert und dann in der anschließenden Fragerunde das Publikum beschimpft, der kann vielleicht aus irgendeinem Grund nicht anders. Wer dessen Schrott aber für ein Festival auswählt, der hat ein anderes Problem …
Vielleicht gibt es nichts Besseres? Ein abwegiger Gedanke: Bei vielen anderen Gelegenheiten kann man Filmfutter sehen, das man individuell vielleicht auch ungut oder abstrus findet, nicht nachvollziehen oder verstehen kann, aber bei dem man zumindest eine Qualität erkennen kann, eine innere Logik oder Linie, bei dem ein Gefühl, eine Stimmung, ein Bild hängen bleibt. Wo aber nichts als Leere und Langeweile ist, da kann man sich nicht einmal mehr reiben.
Das Festival als Bühne
Es liegt in der Natur des Menschen, zu glauben er sei wichtig, sobald er an einem wie auch immer gearteten, irgendwie »exklusiven« Ereignis teilnehmen darf. Das wird individuell mehr oder weniger intensiv empfunden, den einen bringt schon das Umhängen eines normalen Berlinale-Ausweises zum Schweben und Schreiten, andere brauchen noch einen Zusatz-Badge für eine der zahllosen »Lounges« oder VIP-Bereiche: Entscheidend ist, dass andere ausgeschlossen sind, exkludiert eben. Für Wichtigtuerei, Selbstbespiegelung und Egozentrik bis Egomanie ist somit bei einem Filmfestival jedenfalls der Boden bestens bereitet.
Der Grund, weshalb diese Aspekte des Sozialverhaltens bei Veranstaltungen wie der Berlinale kulminieren: Leider treffen, ganz allgemein gesprochen, bei einem Filmfestival viele Berufsbilder aufeinander, in deren Berufsalltag manische Großmannssucht hilfreich ist — und sei es nur zu Zwecken des Selbstbetrugs.
Auch Journalisten, die in der Pressekonferenz in ausufernden Monologen unverständliche Fragen formulieren, suchen im Grunde offenbar ebenfalls die Bühne. Sie haben aber ebenso den Beruf verfehlt, wie Festivalmitarbeiter, die zwar tatsächlich nach einem Film auf der Bühne stehen dürfen, es dort aber nicht verstehen, eine kurze Frage/Antwort-Session nach einem Film zu moderieren, die in den engen Zeitplan passt, sondern stattdessen versuchen, ihr kindliches Ego mit eigenen in einem unbegreifbaren Fantasie-Englisch an die Filmemacher gerichteten, endlosen Nonsense-Fragen zu befriedigen.
Fremdschämen war also durchaus auch ein Thema bei der diesjährigen Berlinale.
Großes Kino
Bei den meisten Filmkritikern und -experten verpönt: großes Kino, bei dem alle Register gezogen werden. Hier gilt bei den meisten, die sich beruflich mit der Bewertung von Kinofilmen befassen, beständiger Kitsch- und Kommerzalarm — die Unschuldsvermutung ist aufgehoben. Je nach Jury-Besetzung kann ein solcher Film zwar durchaus mal einen Preis bekommen, nicht aber mit positiven Reaktionen von Seiten der Filmkritiker rechnen. Eine »déformation professionelle«: Wer ständig beruflich Filme sieht, der muss eben sehr aufpassen, dass er nicht abstumpft und wegen völlig abgebrühter, empfindungsloser Rezeptoren nur noch dann reagiert, wenn seine angestiegene Reizschwelle durch eine höhere Dosis überschritten wird — schneller, härter, kompromissloser, perverser, abstruser.
Da ist es interessant, dass man in dieser Saison offenbar auch mit einer stilistischen Rückwendung erfolgreich sein kann: Der mehrfach oscar-nominierte »The Artist« zeigt es — und auch die Berlinale hatte solche Momente. Etwa wenn neu produzierte Filme im »altmodischen« Seitenverhältnis 4:3 auf die Leinwand kamen. Oder in »Tabu« einem dreiteiligen Schwarzweißfilm, in dessen drittem Teil die Dialoge der handelnden Personen stumm bleiben, während die Geräusche und die Musik der im Film auftretenden Band synchron zu hören sind, und zusätzlich ein Off-Erzähler die Story vorantreibt. »Tabu« erhielt neben dem Alfred-Bauer-Preis auch den Preis der Fipresci, einer internationalen Vereinigung von Filmkritikern und Filmjournalisten.
Downloads zum Artikel:
Empfehlungen der Redaktion:
09.02.2012 – Ray Dolby erhält Berlinale-Kamera
03.02.2012 – Kinoton ist offizieller Supplier der Berlinale
01.02.2012 – Media Logic ist Kooperationspartner der Berlinale 2012
04.02.2012 – Berlinale digital — eine neue Herausforderung